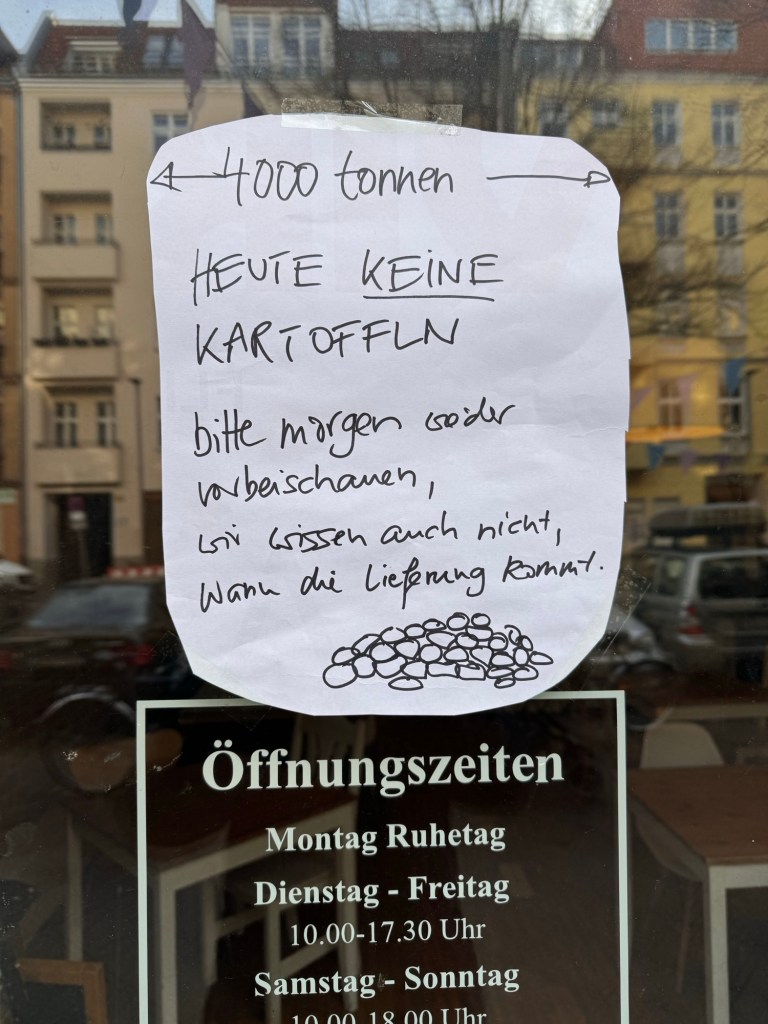Nee, so geht das auch nicht. Die Welt ist doch schon kompliziert genug. Und dann macht man aus einer einfachen Seitenstraße ein Labyrinth? Das soll einer verstehen. Ich bin ja Radfahrer mit Leib und Seele. Und dass man auf den Berliner Hauptstraßen den Autos eine ganze Spur weggenommen hat und sie für die Fahrräder mit Pollern abgesperrt hat (zumindest war das so gemeint. In der Wirklichkeit fährt man weiter Slalom zwischen Lieferwagen, Baustellen und Falschparkern), dafür möchte ich unserer ehemaligen grünen Stadträtin jeden Tag eine Kerze in der Kathedrale meines Herzens anzünden. Ehrlich! Danke Frau Dr. Almut Neumann!
Dass man mit Barrieren, Schildern und Grenzpfählen aber nicht überall eine bessere Welt schaffen kann, merke ich, als ich mal nicht mit dem Rad unterwegs bin, sondern mit dem Moped. Und weil ich die Nebenstraße genommen habe, und weil ich es eilig habe und weil dann da ein Polizist steht, der das ganze Durcheinander sortieren soll. „Fahn se ma rechts ran.“ kommandiert er und winkt mich mit der rechten Hand zu sich, während er das Auto kontrolliert, hinter dem ich zum Halten gekommen bin. „Na, was glauben se, warum sie jetzt hier stehen?“, wendet er sich mit einem makellosen Gebiss breit lächelnd an mich. Blödeste Bullentaktik, aber sie verfängt. Ich soll mich selbst beschuldigen? Tue ich dann auch prompt. Denn so läuft das Spiel: Selbsterniedrigung mit Hoffnung auf Absolution. Kenne ich noch von der katholischen Kirche. Das war auch bei der sozialistischen Selbstkritik so und das ist heute in einem verkehrsberuhigten Kiez mit grüner Wählerschaft nicht anders. „Fahrradstraße?“, rate ich mal so ins Blaue hinein. Ganz tief ist die Reue nicht, denn es ist nicht das erste Mal, dass ich gegen die Gebote der neuen Fahrradstraße verstoße. Im Gegenteil: Jedes Mal nehme ich mit dem Moped trotzig genau diesen Weg, weil es jedes Mal ein kleiner Triumph ist hier gegen alle Verbote durch das Zentrum von Deutsch-Schilda hindurch zu knattern. Mit dem Fahrrad nehme ich die Strecke entlang der Hauptstraße – das geht schneller. „Die Nachbarn haben sich beschwert, dass sich hier zu viele nicht an die Einbahnstraße halten.“, rechtfertigt sich der Wachtmeister, und ich merke, dass es im unangenehm ist. „Und deswegen muss ich jetzt hier rumstehen.“ Da ist ein kleiner Unterton, der mich hoffen lässt. Routiniert kontrolliert er Führerschein und Perso. „Ach sie wohnen ja ganz in der Nähe?“, staunt er. „Versicherung in Ordnung?“ „Ja“, sag ich eifrig, „Neues Kennzeichen gestern drangeschaubt.“ Hoffentlich fragt er mich nicht nach dem Bremslicht, das tut nämlich nicht. Und überhaupt fallen mir alle Sünden wieder ein. So ist das bei mir immer. Aber es gibt einen Trumpf, der bei jedem Berliner Polizisten verfängt: „Also ich finde ja die Fahrradstraße echt eine gute Idee, aber dass das so kompliziert sein muss…“ Kein Berliner Polizist über 50 ist Fahrradfahrer. Und der Schupo mir gegenüber mit seinem stattlichen Bauch unter dem schwarzen Lederwams bestimmt auch nicht. Mein Alter, schätze ich ihn, gemütlich. „Na, dass ich den Quatsch noch vor der Rente machen muss….“ fängt er an. „Also ich hab noch zwei Jahre…“ solidarisiere ich mich sofort. „Nee, ich nur noch 5 Monate – jottseidank!“ Dann versucht er wieder amtlich zu werden. „Also eigentlich sind das 50 Euro…“ Aber ich komme mit einer ernsthaften Verwarnung weg und gelobe Besserung. Fast möchte ich dem freundlichen Mann in Schwarz zum Abschied die Hand schütteln. Aber er ist schon wieder beschäftigt. Das Gegensprechgerät an seiner Brust knarzt. Es ist von Motorola. Die haben mal gute Handys gebaut, vor 20 Jahren. Gibt’s die überhaupt noch? Der Kontaktbereichsbeamte von der Triftstraße wird eine Lücke lassen in der Berliner Polizei, wenn er geht. Gerade seine Gelassenheit brauchen wir hier.
Einen Tag später komme ich an die Stelle zurück. Mit Fahrrad und Fotoapparat. Wir wissen aus den guten Krimis: Der Täter kehrt immer an den Ort der Tat zurück. Waren hier wirklich Einbahnstraßenschilder? Hatte ich gar nicht gesehen? Oh ja! Mehr als genug. Während ich versuche, sie alle auf ein Bild zu bekommen, muss ich immer wieder zur Seite springen, wegen der Autos, die in alle Richtungen durch die Einbahn-Fahrradstraße brettern. Auf dem Rückweg mach ich dann noch ein paar Bilder vom Leben und Überleben auf der Hauptstraße.